Interview
Stephan Schulmeister: »Wir müssen von den Neoliberalen lernen«

23. Mai 2019 | Patrick Schreiner
Stephan Schulmeister über die Strategie, den Erfolg und die Überwindung des Neoliberalismus. Schulmeister ist Ökonom, er war von 1972 bis 2012 wissenschaftlicher Mitarbeiter beim österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO.
Eine Ihrer Thesen ist, dass sich neoliberales Denken durchgesetzt habe, weil Sozialdemokratie und Gewerkschaften sehr erfolgreich waren – bis in die 1970er Jahre hinein. Das klingt paradox.
 Stephan Schulmeister: Als Folge des Aufarbeitens der Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre wurde in den 1950er Jahren und 1960er Jahren eine neue Form von Kapitalismus etabliert. In Deutschland wurde er als »rheinischer Kapitalismus« oder »Soziale Marktwirtschaft« bezeichnet. Das war ein System, das auf allen Ebenen das Profitstreben auf Aktivitäten in der Realwirtschaft lenkte, insbesondere durch strikte Regulierung der Finanzmärkte. Die Basis dessen war die Theorie des englischen Ökonomen John Maynard Keynes, und diese war wiederum Ergebnis des Lernens aus der Weltwirtschaftskrise. Wenn das Profitstreben nur die Turbinen der Realwirtschaft antreiben kann, dann boomt die Wirtschaft. Schon 1960 gab es echte Vollbeschäftigung, in Deutschland und Österreich lag die Arbeitslosenquote unter 1 Prozent. Damit kam ein Prozess der Umverteilung von Macht in Gang. Denn wenn Vollbeschäftigung herrscht, dann verlangen die Gewerkschaften Umverteilung zugunsten der Löhne und Mitbestimmung. Die Streikintensität stieg. Der Zeitgeist drehte auf links, Stichwort 1968. Ab 1970 kam noch die Umweltbewegung dazu, die den Kapitalismus aus ökologischen Gründen zu einem Auslaufmodell erklärte. Alle diese Prozesse zusammengenommen waren einerseits Resultat des Erfolgs der realkapitalistischen Spielanordnung, drängten aber andererseits die Vermögenden immer stärker in die Defensive. Diese begannen, sich nach einer anderen Ideologie umzusehen, denn so konnte es nicht weitergehen. Ich halte das für eine durchaus nachvollziehbare Sichtweise. Ich habe 1975 in Bologna studiert. Wenn damals der mächtigste Industrielle Italiens, der Alleinbesitzer von Fiat, von seinen 185.000 Beschäftigten in irgendeinem Teilwerk 200 kündigen wollte, dann war das schlicht und einfach unmöglich. Er hatte die Dispositionsmacht verloren, denn die Gewerkschaften waren hervorragend organisiert, es gab sofort Streiks.
Stephan Schulmeister: Als Folge des Aufarbeitens der Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre wurde in den 1950er Jahren und 1960er Jahren eine neue Form von Kapitalismus etabliert. In Deutschland wurde er als »rheinischer Kapitalismus« oder »Soziale Marktwirtschaft« bezeichnet. Das war ein System, das auf allen Ebenen das Profitstreben auf Aktivitäten in der Realwirtschaft lenkte, insbesondere durch strikte Regulierung der Finanzmärkte. Die Basis dessen war die Theorie des englischen Ökonomen John Maynard Keynes, und diese war wiederum Ergebnis des Lernens aus der Weltwirtschaftskrise. Wenn das Profitstreben nur die Turbinen der Realwirtschaft antreiben kann, dann boomt die Wirtschaft. Schon 1960 gab es echte Vollbeschäftigung, in Deutschland und Österreich lag die Arbeitslosenquote unter 1 Prozent. Damit kam ein Prozess der Umverteilung von Macht in Gang. Denn wenn Vollbeschäftigung herrscht, dann verlangen die Gewerkschaften Umverteilung zugunsten der Löhne und Mitbestimmung. Die Streikintensität stieg. Der Zeitgeist drehte auf links, Stichwort 1968. Ab 1970 kam noch die Umweltbewegung dazu, die den Kapitalismus aus ökologischen Gründen zu einem Auslaufmodell erklärte. Alle diese Prozesse zusammengenommen waren einerseits Resultat des Erfolgs der realkapitalistischen Spielanordnung, drängten aber andererseits die Vermögenden immer stärker in die Defensive. Diese begannen, sich nach einer anderen Ideologie umzusehen, denn so konnte es nicht weitergehen. Ich halte das für eine durchaus nachvollziehbare Sichtweise. Ich habe 1975 in Bologna studiert. Wenn damals der mächtigste Industrielle Italiens, der Alleinbesitzer von Fiat, von seinen 185.000 Beschäftigten in irgendeinem Teilwerk 200 kündigen wollte, dann war das schlicht und einfach unmöglich. Er hatte die Dispositionsmacht verloren, denn die Gewerkschaften waren hervorragend organisiert, es gab sofort Streiks.
Wie konnten in dieser Situation gerade die Neoliberalen in die erste Reihe rĂĽcken?
Stephan Schulmeister: Es war ihre strategische Stärke, dass sie in den 1950er und 1960er Jahren, um in Ihrem Bild zu bleiben, Schritt für Schritt aus der zweiten Reihe immer mehr in die vorderste Reihe der öffentlichen Debatten gerückt sind. Das haben sie mit großem Fleiß und hervorragender Organisation gemacht. Die Art und Weise, wie das neoliberale Mont-Pèlerin-Netzwerk operierte, war hervorragend. Es war so etwas wie ein langsamer intellektueller Guerilla-Krieg der neoliberalen Denker und Krieger – sie haben sich ja selbst als »freedom fighters« bezeichnet. Die einzelnen Bodentruppen haben unabhängig voneinander agiert. Es gab also keine neoliberale Kommandozentrale. Auch die Mont-Pèlerin-Society hat keine zentralen Direktiven gegeben, im Gegenteil. Ihre Mitglieder hatten einen politischen Willen, der von der tiefen Überzeugung gespeist wurde, dass nach dem Faschismus und dem Stalinismus der immer stärker werdende Sozialstaat die liberale Marktwirtschaft und damit auch die individuelle Freiheit langfristig zerstören würde. Das waren dabei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, wenn man etwa an Karl Popper denkt, der Gründungsmitglied der Mont Pèlerin Gesellschaft war, sich aber später von ihr distanziert hat und ausgestiegen ist. Aber 1947 hatte auch er nachvollziehbarerweise das Gefühl, dass die liberale Demokratie langfristig gefährdet sei.
Weshalb »nachvollziehbarerweise«?
Stephan Schulmeister: Weil für einen Liberalen die Regulierung von Märkten, insbesondere von Arbeitsmärkten, aber auch von Finanzmärkten prinzipiell problematisch ist. Die Neoliberalen, insbesondere die Ordoliberalen, waren nicht gegen eine minimale Absicherung, aber sie lehnten einen umfassenden Sozialstaat ab, der den gesamten Bereich der Gesundheits- und Altersversorgung und der Daseinsvorsorge den Marktkräften gewissermaßen aus der Hand nimmt. Zumal, und auch das war nicht so unrichtig gedacht, ein umfassender Sozialstaat gleichzeitig auch Machtbasis der Gewerkschaften sein würde. Das galt zumindest in Staaten wie Deutschland und Österreich, wo das Prinzip der Selbstverwaltung etabliert wurde, weil der Sozialstaat im Wesentlichen aus Lohnbeiträgen finanziert wurde. Hier würde der Ausbau des Sozialstaates auch den Ausbau sozialstaatlicher Institutionen bedeuten, und damit Ausbau der Macht der Gewerkschaften. Und die Gewerkschaften waren und sind den Neoliberalen ein Dorn im Auge. Die aber sind so klug, auf geschickte Weise ihr politisches Interesse – gegen Sozialismus, gegen Gewerkschaften – mit ökonomischen Überlegungen zur Frage freier Märkte bis hin zu gesellschaftsphilosophischen Fragen – was sind eigentlich die höchsten Werte einer Gesellschaft? – zu verbinden. Sie verwenden dabei einen geschickten Marketing-Trick, indem sie sagen, es gebe einen Wert, der über allen anderen steht: die individuelle Freiheit. Sie brechen so mit der europäischen Tradition des »Ausbalancierens« verschiedener Werte, sei es der Triade von Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe in christlicher Tradition, sei es von »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« in säkulärer Tradition. Sie sagen, Freiheit sei der höchste Wert, und zwar in einem negativen Sinn verstanden als Freiheit von (staatlichem) Zwang (und nicht auch in einem positiven Sinn als Entfaltungsmöglichkeit). Das haben sie nicht unklug durchargumentiert, und angesichts der Unterdrückung der Menschen in »real-sozialistischen« Ländern wurde die neoliberale Doktrin ganz langsam gesellschaftsfähig. Und, ganz wichtig, sie war theoretisch fundiert. Auch wenn das Theoriegebäude unterschiedlich konstruiert war, von der österreichischen Schule über die Chicago School bis hin zum deutschen Ordoliberalismus: Die Schlussfolgerungen, die die Neoliberalen aus ihren unterschiedlichen Denkgebäuden zogen, waren weitgehend die gleichen.
Welche Rolle spielte der Zusammenbruch des Währungssystems von Bretton Woods bei diesem ideologischen Umschwung?
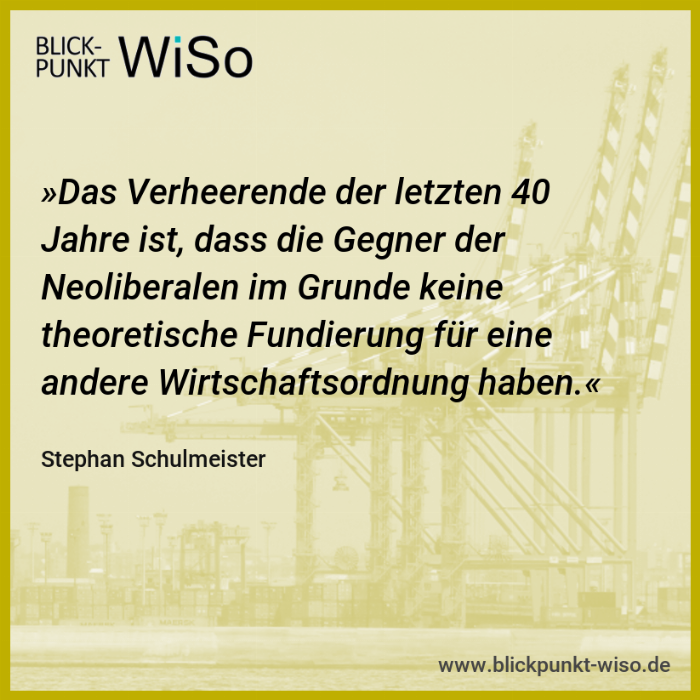 Stephan Schulmeister: Als Auslöser eine außerordentlich wichtige. Denn damit begann der lange Weg in die gegenwärtige Krise, konkret mit der Entwertung des Dollars zwischen 1971 und 1973 und dem nachfolgenden »Ölpreisschock«, der 1974/75 die erste globale Rezession der Nachkriegszeit auslöste. Darauf folgten weitere Schritte der Abkehr von der realkapitalistischen Spielanordnung – also jener Spielanordnung, bei der die Finanzmärkte allesamt strikt reguliert waren. Am Beispiel des Zusammenbruchs von Bretton Woods kann man auch den Scharfsinn der neoliberalen Angreifer erkennen. Sie haben sich in ihrer Offensive gegen Vollbeschäftigungspolitik und Keynesianismus die schwächste Stelle ausgesucht. Das Bretton-Woods-System war eine Fehlkonstruktion, in dem Sinn, dass die nationale Währung des mächtigsten Landes, der US-Dollar, gleichzeitig als Weltwährung fungierte. Diese Entscheidung, die 1944 in Bretton Woods gefallen war, griff dort der schon herzkranke Keynes mit all seiner Kraft an. Aber er hatte sich nicht durchsetzen können. Keynes argumentierte, dass diese Doppelrolle von einer nationalen Währung und gleichzeitig Weltwährung zwingend zu einem Konflikt zwischen den nationalen Interessen des Leitwährungslandes und den globalökonomischen Interessen an einem stabilen Weltwährungssystem führen müsse. Und genau das ist passiert. Die USA haben ihre Position als Weltwährungsland während des Vietnamkrieges ausgenutzt. Sie haben, vereinfacht gesprochen, durch Dollar-Exporte den Vietnamkrieg sehr billig finanziert. Damit haben sie aber gleichzeitig das Vertrauen in die Stabilität des Dollars untergraben. Charles de Gaulle, der französische Präsident, war nur der erste, der die Probe aufs Exempel machte. Er prüfte 1967, ob das Versprechen der USA, Dollar in Gold einzulösen, auch gehalten würde. Es wurde natürlich nicht gehalten. Die französische Zentralbank hat keine Goldbestände für ihre Dollar-Forderungen bekommen. Damit war klar, dass es zum Vertrauensverlust und früher oder später zum Zusammenbruch des Systems kommen würde. Diesen wiederum haben die neoliberalen Ökonomen schon 1953, also 15 Jahre vorher, vorbereitet, indem Milton Friedman die wissenschaftliche Umrahmung für freie Finanzmärkte lieferte; er schrieb dazu einen viel zitierten Artikel. Es ging ihm nicht nur um Devisenmärkte, sondern um alle Finanzmärkte. Er argumentierte, dass Finanzmärkte gar keine destabilisierende Spekulation provozieren könnten. Diese sei lediglich ein vorübergehendes und harmloses Phänomen. So kam die tatsächliche Schwäche des Nachkriegsmodells, Doppelrolle des Dollars, und der Verlust des Vertrauens in diese Weltwährung mit der theoretischen Erklärung der Neoliberalen zusammen. Wenn wir einen Sprung in die Gegenwart machen: Das Verheerende der letzten 40 Jahre ist, dass die Gegner der Neoliberalen im Grunde keine theoretische Fundierung für eine andere Wirtschaftsordnung haben.
Stephan Schulmeister: Als Auslöser eine außerordentlich wichtige. Denn damit begann der lange Weg in die gegenwärtige Krise, konkret mit der Entwertung des Dollars zwischen 1971 und 1973 und dem nachfolgenden »Ölpreisschock«, der 1974/75 die erste globale Rezession der Nachkriegszeit auslöste. Darauf folgten weitere Schritte der Abkehr von der realkapitalistischen Spielanordnung – also jener Spielanordnung, bei der die Finanzmärkte allesamt strikt reguliert waren. Am Beispiel des Zusammenbruchs von Bretton Woods kann man auch den Scharfsinn der neoliberalen Angreifer erkennen. Sie haben sich in ihrer Offensive gegen Vollbeschäftigungspolitik und Keynesianismus die schwächste Stelle ausgesucht. Das Bretton-Woods-System war eine Fehlkonstruktion, in dem Sinn, dass die nationale Währung des mächtigsten Landes, der US-Dollar, gleichzeitig als Weltwährung fungierte. Diese Entscheidung, die 1944 in Bretton Woods gefallen war, griff dort der schon herzkranke Keynes mit all seiner Kraft an. Aber er hatte sich nicht durchsetzen können. Keynes argumentierte, dass diese Doppelrolle von einer nationalen Währung und gleichzeitig Weltwährung zwingend zu einem Konflikt zwischen den nationalen Interessen des Leitwährungslandes und den globalökonomischen Interessen an einem stabilen Weltwährungssystem führen müsse. Und genau das ist passiert. Die USA haben ihre Position als Weltwährungsland während des Vietnamkrieges ausgenutzt. Sie haben, vereinfacht gesprochen, durch Dollar-Exporte den Vietnamkrieg sehr billig finanziert. Damit haben sie aber gleichzeitig das Vertrauen in die Stabilität des Dollars untergraben. Charles de Gaulle, der französische Präsident, war nur der erste, der die Probe aufs Exempel machte. Er prüfte 1967, ob das Versprechen der USA, Dollar in Gold einzulösen, auch gehalten würde. Es wurde natürlich nicht gehalten. Die französische Zentralbank hat keine Goldbestände für ihre Dollar-Forderungen bekommen. Damit war klar, dass es zum Vertrauensverlust und früher oder später zum Zusammenbruch des Systems kommen würde. Diesen wiederum haben die neoliberalen Ökonomen schon 1953, also 15 Jahre vorher, vorbereitet, indem Milton Friedman die wissenschaftliche Umrahmung für freie Finanzmärkte lieferte; er schrieb dazu einen viel zitierten Artikel. Es ging ihm nicht nur um Devisenmärkte, sondern um alle Finanzmärkte. Er argumentierte, dass Finanzmärkte gar keine destabilisierende Spekulation provozieren könnten. Diese sei lediglich ein vorübergehendes und harmloses Phänomen. So kam die tatsächliche Schwäche des Nachkriegsmodells, Doppelrolle des Dollars, und der Verlust des Vertrauens in diese Weltwährung mit der theoretischen Erklärung der Neoliberalen zusammen. Wenn wir einen Sprung in die Gegenwart machen: Das Verheerende der letzten 40 Jahre ist, dass die Gegner der Neoliberalen im Grunde keine theoretische Fundierung für eine andere Wirtschaftsordnung haben.
Was genau aber hatten nun die freien Finanzmärkte mit dem Durchbruch des Neoliberalismus als politisches System zu tun?
Stephan Schulmeister: Das war der absolut entscheidende Punkt. Die politischen Forderungen der Neoliberalen hätten in Europa überhaupt keine Chance gehabt, selbst wenn die Vermögenden ihre Positionen langsam wechselten und gegenüber Sozialstaat, Gewerkschaften und Sozialdemokratie immer kritischer wurden. Die große Mehrheit der Menschen in Europa wollte das Europäische Sozialmodell. Aber durch die Hintertür der Entfesselung der Finanzmärkte hat man scheinbare Sachzwänge produziert, nämlich einen Anstieg der Staatsverschuldung und der Arbeitslosigkeit. Die erste Krise beginnt 1971. Dann hatten wir 1973 als Folge der Aufgabe von Bretton Woods den ersten Ölpreisschock, weil die erdölexportierenden Staaten es sich nicht haben gefallen lassen, dass die Währung, in der sie bezahlt werden, so stark abwertete. Der erste Ölpreisschock führte zur Rezession, weltweit stiegen Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung. Drei Jahre später wiederholt sich das Spiel. Und gleichzeitig stieg die Inflation. Es gab in den 1970er Jahren also einen gleichzeitigen massiven Anstieg von Arbeitslosigkeit und Inflation. Hier nun kam der nächste bedeutende theoretische Schlag der Neoliberalen: Sie haben die Keynesianer gewissermaßen beim Wort genommen. Die hatten immer behauptet, dass es ein Entweder-Oder gebe. Entweder steige die Inflation, dann gehe die Arbeitslosigkeit zurück, oder umgekehrt. Das war die so genannte Philipps-Kurve. Meiner Meinung nach war die theoretischer Unsinn, und das nutzten die Neoliberalen aus. Sie verwiesen darauf, dass es Arbeitslosigkeit und Inflation gleichzeitig gab – die keynesianische Theorie müsse also falsch sein. Das war ein unheimlich genialer Trick. Sie nützten eine Schwäche der keynesianischen Theorie, provozierten aber selbst eine Situation, in der diese Schwäche zum massiven Problem wurde. Sie hatten ja dafür gekämpft, dass das System der festen Wechselkurse aufgegeben wurde. Diese Aufgabe von Bretton Woods hat indirekt zwei Ölpreisschocks und Wirtschaftskrisen verursacht. Und dann sagten sie: »Jetzt haben wir Euch erwischt! Die Annahme, Arbeitslosigkeit und Inflation stünden in einem gegenläufigen Verhältnis, ist falsch!« Das war das vielleicht entscheidendste Ereignis. Denn genau ab diesem Zeitpunkt, Mitte der 1970er Jahre, wurden die ökonomischen Lehrbücher umgeschrieben. Das galt als die totale Niederlage des Keynesianismus. Und wenn damals die Lehrbücher neu geschrieben wurden, dann begann zugleich der Prozess, der aus heutiger Sicht schon Jahrzehnte andauert, dass die Universitäten im Grunde nur noch neoliberal eingeschulte Ökonomen hervorbringen. Und die sitzen dann natürlich in allen wichtigen Institutionen: in den Minister-Vorzimmern, bei der Europäischen Zentralbank, den europäischen Institutionen usw.
Wie kann es in einer solchen Situation wieder gelingen, einer anderen Wirtschaftspolitik zum Durchbruch zu verhelfen?
Stephan Schulmeister: Das ist das Problem. Das wird nicht leicht sein. Hayeks Plan lautete damals: Wir müssen die Köpfe der Intellektuellen gewinnen. Das meinte er in einem breiten Sinne, Wissenschaft, Politik, Medien usw. Wenn wir die Köpfe dieser Leute für unsere Ideologie gewinnen, so Hayek, dann reproduziert sich das Denksystem quasi von selbst. Die Neoliberalen brauchen dann nur noch zuzuschauen, wie die Gesellschaft sich wandelt. Das hat sich auf verheerende Weise als richtig erwiesen. Man braucht nur einmal anzusehen, wie Wirtschaftsjournalisten in ihrer überwältigenden Mehrheit schreiben, und das schon seit Jahrzehnten. Um einen Kurswechsel zu erreichen, muss der Zweifel Schritt für Schritt wachsen. Kopfarbeiter müssten sich vom Neoliberalismus abwenden angesichts seiner gesamtgesellschaftlich verheerenden Folgen. Dazu müssen sie aber natürlich erst einmal die Verbindung sehen, müssen den Neoliberalismus als Wegbereiter von Nationalismus und Rechtspopulismus erkennen. So ist das übrigens in den späten 1920er Jahren auch gewesen. Ich bezweifle, dass viele Intellektuelle das heute schon in dieser Klarheit sehen. Wobei die Frage ist, ob sie es überhaupt sehen können. Denn wenn sie es würden, müssten sie sich die Frage stellen, inwiefern sie selbst zum Erstarken des Rechtspopulismus durch ihr Schreiben gegen den Sozialstaat beigetragen haben. Das ist eine auch psychologische Herausforderung. Deswegen betone ich in meinem Buch sehr, dass es eine neue umfassende Erzählung braucht, eine konkrete Theorie. Ich habe das Buch überhaupt erst deshalb geschrieben. So wie die Neoliberalen einst im Verborgenen ihre Theorie geschaffen und über Jahrzehnte immer mehr Kopfarbeiter überzeugt haben, insbesondere in den Wirtschaftswissenschaften, so ähnlich wird man auch eine Gegenbewegung aufbauen müssen. Und da sieht es düster aus, weil es an der unglaublichen Geduld fehlt, die eine solche Arbeit erfordert. Da helfen Patentlösungen wie »Gemeinwohlökonomie«, »Vollgeld«, »Postkapitalismus« und andere nicht weiter. Wir haben keinen neuen Bedarf an Heilslehren. Wir brauchen vielmehr Erklärungen; wir brauchen eine Navigationskarte, die übrigens auch für andere attraktiv ist, die üblicherweise nicht als Verbündete für eine sozialere Politik gesehen werden, nämlich die realkapitalistischen Unternehmer. Ohne eine Theorie, die gleichzeitig erklärt, dass und wie auch Klein- und Mittelbetriebe Opfer dieses Systems wurden, etwa durch Finanzkrisen, kommen wir nicht weiter. Klar, die haben in den 1970er Jahren auf das falsche Pferd gesetzt, aber auch sie müssen erkennen, dass das eine fundamentale Fehlentwicklung war.
Das dürfte ihnen ähnlich schwer fallen wie der Sozialdemokratie, die ja auch jahrzehntelang auf das falsche Pferd gesetzt hat.
Stephan Schulmeister: Klar, wir müssen die Entwicklung quasi von hinten wieder aufwickeln. Die erste Gruppierung, die ihre fundamentalen Fehler erkennen muss, ist deshalb die Sozialdemokratie, zum Teil auch die Gewerkschaften. Wenn ich den Prozess Revue passieren lasse, stelle ich fest, dass sich ab den späten 1970er Jahren zunächst die Reichen von der Sozialstaatlichkeit abgewendet haben. Erst 20 Jahre später ist die Sozialdemokratie gefolgt – ich nenne Blair und Schröder. Nach 1989, dem Zusammenbruch des Realsozialismus, wurde die internationale Sozialdemokratie ganz wesentlich von Deutschland und England aus bestimmt. Die Sichtweise war, dass der Neoliberalismus nicht besiegbar sei, die Sozialdemokratie daher die Rolle der sozialeren Alternative innerhalb des Neoliberalismus übernehmen müsse. Es war die Logik des kleineren Übels. Was sie nicht verstanden haben, war, dass die Sparpolitik eine Waffe ist, um die europäischen Sozialstaaten zu zerstören. Heute sind die Menschen verbittert und suchen soziale Wärme rechts – in Vorstellungen von Volksgemeinschaften. Das Umdenken der Sozialdemokratie muss daher in der Sozialstaatsdebatte beginnen: beim Wohnen, bei der Rente, bei Hartz IV. Wichtig ist, dass die grundlegende Aufarbeitung der zurückliegenden Fehler vor der nächsten Finanzkrise erfolgt. Denn nur dann ist man glaubwürdig. Eine sozialdemokratische Partei sollte sich zudem als Partei der Klein- und Mittelbetriebe verstehen. Das ist kein Gegensatz zur Arbeit, wenn wir uns vor Augen führen, dass sich im Realkapitalismus Löhne und Gewinne gegenseitig steigern. Es braucht eben eine andere Theorie, die zeigt, dass freie Finanzmärkte zu Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung führen, dass Sachzwänge direkt in die marktkonforme Demokratie leiten. Die Sozialdemokratie muss den Neoliberalismus als »falsches Ganzes« im Ganzen und damit frontal angreifen. Dabei kann man von den strategisch klugen Neoliberalen lernen: Die führten einen klaren Angriff, einen Krieg der Weltanschauungen, kannten prinzipiell nur Schwarz und Weiß – etwa in ihrer Gegenüberstellung von Freiheit und Knechtschaft. 







Patrick Schreiner ist Gewerkschafter und Publizist aus Bielefeld/Berlin. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören Wirtschaftspolitik, Verteilung, Neoliberalismus und Politische Theorie.
