Was ist eine Krise? Ein RÞckblick auf die Wirtschafts- und Finanzkrisen 2008 und 2010

2. Mai 2019 | Walter Otto Ãtsch, Stephan PÞhringer
Dass die Ãķkonomische Zunft Krisen durch eine ideologische Brille interpretiert, zeigt ein Blick auf Ãķffentliche und wissenschaftliche Diskussionen um die Finanz- und Wirtschaftskrisen 2008 und 2010. Die Grenzen zwischen Politik und Wissenschaft sind flieÃend.
Krise 2008
Ab Herbst 2008 dominierte in der Medienberichterstattung eine Darstellung der damaligen Situation als ÂŧKriseÂŦ. An dieser Debatte nahmen auch viele ÃkonomInnen teil, von denen einige sich drei Jahre vorher im ÂŧHamburger AppellÂŦ zu Wort gemeldet hatten. Damals prÃĪsentierten sie angebotsseitige GrÞnde fÞr die vermeintliche Krise: ÂŧHohe Arbeitskosten und hohe SteuerlastenÂŦ wÞrden Âŧunmittelbar die InvestitionsbereitschaftÂŦ mindern und sofortige Reaktionen am Arbeitsmarkt und in der Sozialpolitik erfordern: ÂŧDie Arbeitskosten [sind, Anm. d. A.] ein SchlÞssel zur Ãberwindung der deutschen WachstumsschwÃĪche.ÂŦ
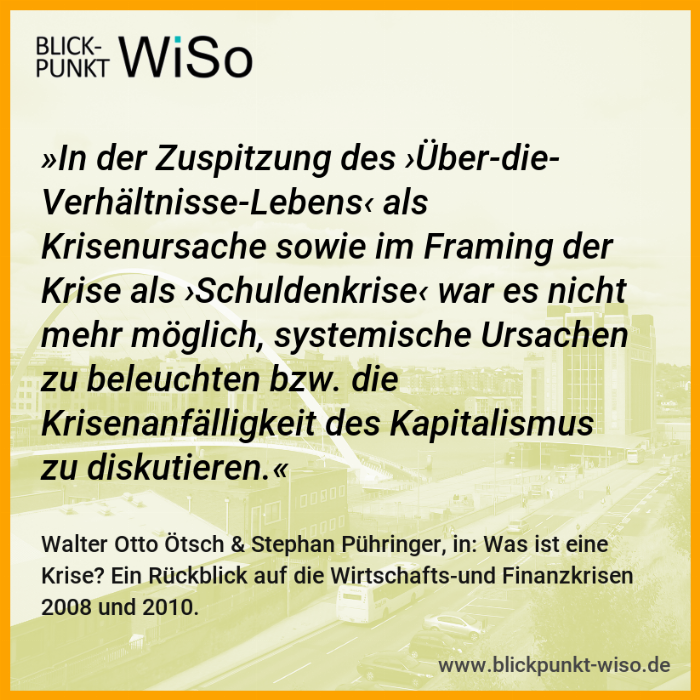 Diese ÃkononomInnen waren jetzt - 2008 - mit ihrem ÂŧSachverstandÂŦ deutlich zurÞckhaltender. Im Unterschied zu 2005 konnten sie nicht eindeutig sagen, ob 2008 Þberhaupt eine ÂŧKriseÂŦ vorliegt, von welcher Art sie ist und was politisch mit welcher Dringlichkeit unternommen werden mÞsse. Eine umfassende Reaktion wie 2005 mit eindeutigen Aussagen und der Aufforderung zu sofortigem Handeln war von ihnen in der Finanzkrise nicht zu hÃķren. Offensichtlich lag fÞr sie im Jahre 2008 eine ganz andere ÂŧKriseÂŦ vor, als dies fÞr 2005 behauptet wurde.
Diese ÃkononomInnen waren jetzt - 2008 - mit ihrem ÂŧSachverstandÂŦ deutlich zurÞckhaltender. Im Unterschied zu 2005 konnten sie nicht eindeutig sagen, ob 2008 Þberhaupt eine ÂŧKriseÂŦ vorliegt, von welcher Art sie ist und was politisch mit welcher Dringlichkeit unternommen werden mÞsse. Eine umfassende Reaktion wie 2005 mit eindeutigen Aussagen und der Aufforderung zu sofortigem Handeln war von ihnen in der Finanzkrise nicht zu hÃķren. Offensichtlich lag fÞr sie im Jahre 2008 eine ganz andere ÂŧKriseÂŦ vor, als dies fÞr 2005 behauptet wurde.
GrundsÃĪtzliche Kritiken kamen 2008 meist nur von AuÃenseitern, die die mangelnde Regulierung des Finanzsektors, die bewusste Schaffung und Tolerierung unregulierter Rahmen in Offshorezentren oder Regulierungsoasen (Ãtsch et al. 2014) oder die tendenzielle Zunahme von sozialer Ungleichheit in kapitalistischen Gesellschaften (Piketty 2014) mit deren KrisenanfÃĪlligkeit in Verbindung brachten. Hier wurden auch jene Ãķkonomischen Theorien problematisiert, die die Grundlagen fÞr das moderne Finanzsystem dargestellt hatten, wie etwa die Effizienzmarkthypothese von Eugene Fama oder das Black-Scholes-Merton Model, und diesen Denkweisen eine (Teil-)Schuld am Ausbruch der Krise zuschrieben. Im FrÞhling 2009 war auch (begleitend zu den Konjunkturrettungsprogrammen) von einem ÂŧKeynesianischen MomentÂŦ die Rede (Hirte 2013: 78ff.) â mit einer zeitweisen AbschwÃĪchung der angebotsorientierten Logik. Der ÂŧWirtschaftsweiseÂŦ Christoph Schmidt meinte jetzt: ÂŧEin guter MakroÃķkonom kann nie nur angebotsorientiert sein oder nur nachfrageorientiert. Ich mÃķchte auf keinen der beiden verzichten â weder auf Keynes noch auf FriedmanÂŦ (zit. in: Spiegel vom 8.3.2009). Aber auch in dieser Rhetorik haben es die meisten ÃkonomInnen vermieden, die Finanzkrise als Krise des Wirtschaftssystems sowie als Indiz fÞr eine Krise des eigenen Faches zu deuten.
Am Anfang des Krisendiskurses ab 2008 war auch nicht von einer Krise des Wirtschaftssystems, sondern von einer Krise der USA die Rede: ÂŧNichts und niemand scheint ein Ãbergreifen der amerikanischen Krise auf die deutsche Wirtschaft noch stoppen zu kÃķnnenÂŦ, so Thomas Straubhaar im Spiegel vom 30.9.2008. Und Berhard Felderer, damals Chef des IHS, sprach in den Salzburger Nachrichten vom 18.9.2008 von einer Âŧchaotischen Situation auf dem amerikanischen FinanzmarktÂŦ, die sich auch auf Europa auswirke.
Analysen zu den Stellungnahmen von ÃkonomInnen in fÞhrenden deutschsprachigen Pressemedien ab 2008 zeigen, dass sie vor allem zweifach argumentiert haben (vgl. Debertin 2012, Hirte 2013 und PÞhringer/Egger 2018). Zum einen wurde die Finanzkrise moralisch ÂŧerklÃĪrtÂŦ: Es seien moralische Regeln verletzt worden und Banker hÃĪtten unethisch gehandelt. Der deutsche BundesprÃĪsident und frÞhere IWF-ChefÃķkonom, Horst KÃķhler, sprach Anfang Oktober 2009 auf der Festveranstaltung zum 60-jÃĪhrigen Bestehen des Deutschen Gewerkschaftsbundes von den ÂŧHÞtchenspielern im Shadow-BankingÂŦ sowie einem Âŧnoch nicht gezÃĪhmten MonsterÂŦ bei gleichzeitiger Inanspruchnahme des Ordoliberalismus: ÂŧDie ordnungspolitischen Vordenker unserer Sozialen Marktwirtschaft haben Recht behalten: Der Markt alleine richtet nicht alles zum GutenÂŦ (Zeit vom 5.10.2009). Thematisiert wurde vor allem das ÂŧMoral HazardÂŦ von Bankern durch Anreize, Âŧdie die Banken veranlassen, zu groÃe Risiken einzugehen, weil sie am Ende die Rechnung nicht bezahlen mÞssenÂŦ, so z. B. JÞrgen Stark, der ehemalige ChefÃķkonom der EZB (im Spiegel vom 23.11.2009). Aber die Moralisierungsdebatte â auch in einer Schuldzuweisung an Personen â ging manchen zu weit. Hans-Werner Sinn, der in den Medien als prominentester Ãkonom Deutschlands fungierte, grub im Oktober 2008 die stÃĪrksten HÃĪmmer aus: ÂŧIn jeder Krise wird nach Schuldigen gesucht, nach SÞndenbÃķcken. Auch in der Weltwirtschaftskrise von 1929 wollte niemand an einen anonymen Systemfehler glauben. Damals hat es in Deutschland die Juden getroffen, heute sind es die ManagerÂŦ (Tagespiegel vom 27.10.2008).
Zum Zweiten wurde die Finanzkrise mit Analogien zu Krankheit und Naturereignissen beschrieben: Die aktuelle Wirtschaft habe Fieber und die Finanzkrise sei wie ein Tsunami oder ein Erdbeben hereingebrochen. ÂŧNiemand konnte sich vorstellen, dass ein solches Ereignis das System weltweit erschÞttert: dass Kredite, in Wertpapiere umgewandelt, einen solchen Ãķkonomischen Tsunami auslÃķsen wÞrden, dass die Wellen auch noch den letzten Kleinsparer in der deutschen Provinz Þberrollen kÃķnnen. âDie Globalisierung der Finanzindustrie reicht viel weiter, als viele dachtenâ, sagt der Ãkonom BurdaÂŦ (Spiegel vom 15.12.2008, Michael Burda war dann von 2011 bis 2014 Vorsitzender des Vereins fÞr Sozialpolitik, der wichtigsten Vereinigung von ÃkonomInnen in Deutschland).
ÂŧBegrÞndungenÂŦ dieser Art entfachen ihre Wirkungen: Sie erklÃĪren die Finanzkrise zu einer bedauernswerten Ausnahme, die mit der eigentlichen Funktionsweise des Wirtschaftssystems wenig zu tun habe. Dadurch wurde die Politik auch nicht aufgefordert, das Finanzsystem umfassend neu zu organisieren, damit eine neue Finanzkrise in der Zukunft nicht mehr auftreten kann. Gleichzeitig wurde auf diese Weise auch die eigene Wissenschaft geschÞtzt, sie sollte durch die Finanzkrise 2008 und die Wirtschaftskrise 2009 nicht in Frage gestellt werden. Damit konnte auch der eigene Beitrag zur Entstehung der Krise nicht ernsthaft in Augenschein genommen werden. Die meisten ÃkonomInnen hatten z.B. vor der Finanzkrise 2008 viele Jahre lang mit Erfolg eine Deregulierung des Finanzsystems gefordert. Gerade die FinanzmÃĪrkte, so dachte man, kÃĪmen dem idealen Markt, wie er in den LehrbÞchern unterrichtet wird, besonders nahe: Hier bilden sich blitzschnell Preise, die (wie das wichtigste Modell Âŧdes MarktesÂŦ besagt) immer ein Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage garantieren. Dass bestimmte FinanzmÃĪrkte, wie der Interbankenmarkt, der Markt fÞr RepogeschÃĪfte oder Geldmarktfonds 2007 und vor allem im Herbst 2008 fast zum Erliegen gekommen sind, konnte im Denken Âŧdes MarktesÂŦ (Ãtsch 2019) nicht erahnt, nicht einmal fÞr mÃķglich gehalten werden. Der deutsche SachverstÃĪndigenrat zum Beispiel hat kontinuierlich Þber Jahrzehnte Finanzinnovationen positiv beurteilt, auch die, die dann direkt die Finanzkrise ausgelÃķst haben (vgl. Wienert 2009). Eugen Fama, der BegrÞnder der Effizienzmarkthypothese, wurde im Jahre 2010 gefragt, wie er sich im RÞckblick die Ereignisse im Jahre 2008 erklÃĪre: ÂŧWarum hat es eine Kreditblase gegeben?ÂŦ Seine selbstbewusste Antwort war: ÂŧIch weià gar nicht, was das bedeutet. (âĶ) Ich weià nicht einmal, was Kreditblase bedeutet. Diese Worte sind populÃĪr geworden. Ich glaube, sie haben Þberhaupt keine Bedeutung. [âĶ Die Kredite fÞr HauskÃĪufe, Anm. d. A.] waren staatliche Politik, kein Marktversagen. (âĶ) Wir wissen nicht, was Rezessionen verursacht haben. (âĶ) Wir werden es nie wissen. (âĶ) Die Ãkonomie ist nicht sehr gut darin, den Umschwung in Ãķkonomischen AktivitÃĪten zu erklÃĪren.ÂŦ Und auf die Frage: ÂŧSie denken immer noch, dass der Markt insgesamt hoch effizient ist?ÂŦ, meinte Fama ÂŧJa. Und wenn er es nicht ist, dann wird es unmÃķglich sein, dass zu sagen.ÂŦ (Cassidy 2010, eigene Ãbersetzung)
ÂŧVon wenigen Ausnahmen abgesehen suchen die Ãkonomen heute die Schuld ausschlieÃlich bei anderen,ÂŦ meinte Gebhard KirchgÃĪssner zur Finanzkrise (KirchgÃĪssner 2009) â auch direkt zu medial wirksamen Ãkonomen: ÂŧSo sieht z.B. der âKronberger Kreisâ, ein einflussreiches privates Gremium rechtsliberaler deutscher Wirtschafts- und Rechtsprofessoren, in seiner Stellungnahme zur Finanzmarktkrise die Schuld ausschlieÃlich beim Verhalten der Bankmanager sowie vor allem bei der Politik. (âĶ) Vielleicht hÃĪtte man aber vom âKronberger Kreisâ erwarten dÞrfen, dass er frÞher auf die mit dieser Politik verbundenen Probleme aufmerksam gemacht hÃĪtte. In all den vielen Stellungnahmen, die dieses Gremium in den vergangenen Jahren herausgegeben hat und die regelmÃĪÃig âmehr Marktâ in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen forderten, findet sich darÞber oder auch zum Problem einer sinnvolleren Regulierung der FinanzmÃĪrkte nichtsÂŦ (ebenda: 8f.; vgl. zum Kronberger Kreis, seinen Netzwerken und seiner Bedeutung fÞr die Geschichte der Wirtschaftspolitik Deutschlands Ãtsch u.a. 2017).
Aber auch KirchgÃĪssner bezieht diese Kritik nicht auf die Ãķkonomische Theorie: ÂŧDie Schuld daran bei den mathematischen Modellen zu suchen, greift aber zu kurz. (âĶ) Wenn z.B. (wie kÞrzlich in St. Gallen) das Dach einer erst vor kurzem errichteten Sporthalle einstÞrzt, wird man untersuchen, wo die Konstruktionsfehler gelegen haben, um ein solches UnglÞck in Zukunft zu vermeiden, aber man wird deshalb nicht das ganze Gebiet der technischen Statik oder schon gar nicht die gesamte Physik als ÞberholungsbedÞrftig ansehen. Ãhnliches sollte auch fÞr die Ãkonomie geltenÂŦ (KirchgÃĪssner 2009: 8).
All das hatte zur Wirkung, dass sich auch in den LehrbÞchern seit 2008 kaum etwas verÃĪndert hat. Als Beispiel verweisen wir auf das Lehrbuch von Mankiw und Taylor. In der 5. (deutschen) Auflage 2012 wurde ungefÃĪhr auf Seite 1000 ein neues Kapitel mit 25 Seiten zur Finanzkrise eingefÞgt. Helge Peukert (2016: 125f.) bezeichnet das als einen Âŧrecht vage[n] Rundumschlag hinsichtlich der Ursachen der FinanzkriseÂŦ, wie eine Âŧweitgehende DeregulierungÂŦ, die mit Âŧgesellschaftlichen VerÃĪnderungenÂŦ zusammenhing. Es gab Âŧmathematische ZaubereiÂŦ, Âŧviele hielten den Konjunkturzyklus fÞr Þberwunden und so weiter.ÂŦ NebulÃķs heiÃt es dann: ÂŧDen unstillbaren Durst nach Krediten auf beiden Seiten des Atlantiks sehen viele als Grund der Finanzkrise anÂŦ (Mankiw/Taylor 2012: 1000). Peukert zieht zu diesem Kapitel im Lehrbuch folgendes ResÞmee: ÂŧZwar werden im Folgenden der Subprime-Markt, Verbriefungen, die Bonuskultur, Informationsasymmetrien und so weiter mit deskriptiven Einsprengseln aus dem turbulenten Krisengeschehen erwÃĪhnt, aber Þber das Aneinanderreihen von Ereignisschnipseln zum Thema geht es nicht hinaus. Oft wird unterstellt, es handele sich um situativ bedingte, verstÃĪndliche (allzu menschliche) AusrutscherÂŦ (Peukert 2016: 126).
Krise 2010
Die Debatte um die Staatsschulden ab Herbst 2009 kann als Fortsetzung des Krisendiskurses seit 2008 verstanden werden und basiert auf den spezifischen Deutungen der Finanzkrise 2008, die ihr weder eindeutige Ursachen zugeordnet noch ein dringliches Handeln von der Politik gefordert hatten. Damit konnte Þberraschend schnell eine deutliche Verschiebung im Krisendiskurs stattfinden. Die spÃĪrliche Debatte der Finanzkrise 2008 als systemischer Krise des Wirtschaftssystems wurde damit verdrÃĪngt â mehr noch: Die Debatte um die Finanzkrise Þberhaupt wurde in den Medien fast zur GÃĪnze beendet. Anstelle der (ungenÞgend thematisierten) Finanzkrise 2008 wurden ab Herbst 2009 bzw. FrÞhling 2010 die ÂŧStaatsschuldenÂŦ und die ÂŧEurokriseÂŦ in den Vordergrund gerÞckt. Dabei wurde in hohem MaÃe an den moralischen Diskurs ab 2008 angeknÞpft. Dies erfolgte nach zwei Richtungen: in Bezug auf das Ausland (vor allem Griechenland) â hier hÃĪtte es ein moralisches Fehlverhalten von PolitikerInnen gegeben; und in Bezug auf das Inland: hier mÞssten aus moralischen GrÞnden die AnsprÞche an den Sozialstaat zurÞckgeschraubt werden. Das stÃĪrkste Bild in diesem Moraldiskurs bildete in Deutschland die ÂŧSchwÃĪbische HausfrauÂŦ: ÂŧMan hÃĪtteÂŦ so Angela Merkel am CDU-Parteitag in Stuttgart Anfang Dezember 2008 Âŧhier in Stuttgart, in Baden-WÞrttemberg, einfach nur eine schwÃĪbische Hausfrau fragen sollen. Die hÃĪtte uns eine ebenso kurze wie richtige Lebensweisheit gesagt: Man kann nicht Þber seine VerhÃĪltnisse leben. Das ist der Kern der KriseÂŦ (zit. in: Spiegel vom 1.12.2008).
Die Finanzkrise 2008 hatte zur Folge, dass das kreditfinanzierte Wachstumsmodell der europÃĪischen ÂŧSÞdstaatenÂŦ, das in den Jahren vorher fÞr hohe Wachstumsraten gesorgt hat, zusammengebrochen ist. Das exportorientierte Modell vor allem von Deutschland blieb erhalten. Deutschland wurde in seiner Rolle als Schwergewicht in der EU aufgewertet. Dies hatte auch zur Folge, dass der deutsche Moraldiskurs fÞr die gesamte EU dominant werden konnte. Anhand der Metapher von der ÂŧSchwÃĪbischen HausfrauÂŦ konnte die Moralisierung der Ursachen der Finanzkrise zu einem allgemeinen Narrativ des ÂŧÃber-die-VerhÃĪltnisse-LebensÂŦ umgedeutet und auf die Problematik der gestiegenen Staatschulden umgelegt werden (PÞhringer 2015). Auf juristischer Ebene manifestiert sich dieser Wandel in den folgenden Jahren in einer Reihe von Gesetzgebungen, wie dem EuropÃĪischen Semester 2010, dem Euro-Plus-Pakt und dem EuropÃĪischen StabilitÃĪtsmechanismus 2011 und dann insbesondere dem EuropÃĪischen Fiskalpakt 2012. Die Intention dieser Gesetzesreformen zeigt sich eindrÞcklich an der Festlegung des damaligen EU-WÃĪhrungskommissars Olli Rehn (2010) im Zuge einer Pressekonferenz: ÂŧSanctions should be the normal, almost automatic, consequence to be expected by countries in breach of their commitmentsÂŦ. Lukas Oberndorfer (2012) beschreibt diese juristischen Schritte einer zunehmenden AusteritÃĪtsdoktrin daher auch treffend als ÂŧautoritÃĪren KonstitutionalismusÂŦ.
Auf diskursiver Ebene wiederum widerspiegelt sich in der Umdeutung von einer Finanzkrise in eine Staatsschuldenkrise eine Umkehrung von Krisenursachen und Krisenauswirkungen. So wurde in vielen Studien klar festgestellt, dass der Anstieg der Staatsschuldenquoten in Europa unmittelbar auf die Konjunktur- und Bankenrettungsprogramme zurÞckzufÞhren ist, die in den Jahren 2008 und 2009 durchgefÞhrt wurden, um die Ãķkonomischen InstabilitÃĪten sowie die teilweise dramatischen Ãķkonomischen Auswirkungen der Krise, insbesondere auf den ArbeitsmÃĪrkten, einzudÃĪmmen (etwa Heimberger 2015). In der Zuspitzung des ÂŧÃber-die-VerhÃĪltnisse-LebensÂŦ als Krisenursache bei Angela Merkel sowie im verÃĪnderten Framing der Krise als ÂŧSchuldenkriseÂŦ werden nun diese erhÃķhten Staatsschulden problematisiert und als Krisenursachen ausgemacht â und dies meist ohne groÃen Ãķffentlichen Widerspruch.
In dieser Deutung ist es nun nicht mehr mÃķglich, gesamtsystemische Ursachen der Krise zu beleuchten, bzw. die KrisenanfÃĪlligkeit des kapitalistischen Wirtschaftssystems als Ganzes zu diskutieren. So stellt Hans-Werner Sinn in der ZEIT vom 25.6.2009 fest: ÂŧEs ist ein systemischer Fehler im Finanzbereich, nicht ein Fehler des kapitalistischen Systems. Ein Problem waren die unzureichenden Eigenkapitalvorschriften, die die Manager an der Wallstreet zu GlÞcksrittern gemacht haben. Marktwirtschaft ist ja kein System, wo jeder tun und lassen kann, was er willÂŦ. Gleichsam geht mit der Verschiebung der Wahrnehmung der Krisenursachen auch eine Verschiebung in der Frage des besten Umgangs mit der Krise einher. Somit kommt es immer stÃĪrker zu einer Fixierung auf die HÃķhe der Staatsschulden und zu einer Ausblendung anderer Ursachen der Krise sowie MissstÃĪnden im Finanzsystem, die mit dem Ausbruch der Finanzkrise offenbar wurden. Dabei wurde im politischen und Ãķffentlichen Diskurs dem Ãķkonomischen Narrativ gefolgt, dass Schulden per se abzulehnen seien, bzw. es einen absoluten HÃķchststand der Staatsschuldenquote gÃĪbe, der Ãķkonomisch bedrohlich sein kÃķnnte. Dieses Narrativ stÞtzte sich auch auf die Arbeiten von Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff (2010), die empirisch einen solchen HÃķchststand bei 90% des BIPs berechneten. Auch wenn drei Jahre spÃĪter nachgewiesen werden konnte, dass dieser Wert auf Datenauswertungsfehler zurÞckzufÞhren ist und Reinhart und Rogoff ihre Ergebnisse auch zurÞcknahmen, war die Aussage dennoch eine der zentralen Grundlagen fÞr die AusteritÃĪtspolitik in Deutschland und Europa â sowohl der damalige deutsche Finanzminister Wolfgang SchÃĪuble als auch der BundesbankprÃĪsident Jens Weidmann haben sich mehrmals auf diese Studie bezogen.
Zusammenfassend zeigt sich also schon sehr frÞh, dass es im Zuge der Finanzkrise zwar zu einem Âŧkeynesianischen MomentÂŦ (Krugman) gekommen sein mag, mit der diskursiven Krisenumdeutung von einer Finanzkrise in eine Staatsschuldenkrise aber die RÃĪume fÞr tatsÃĪchliche Neuorientierungen innerhalb der Ãķkonomischen Disziplin als auch fÞr wirtschafts- und finanzmarktpolitische Reformen zunehmend enger wurden. Der moralische Frame des ÂŧÃber-die-VerhÃĪltnisse-LebensÂŦ als Kern der Krise, der schlieÃlich in die Schuldenbremse und spÃĪter den Fiskalpakt auf EU-Ebene mÞndete, wurde dabei noch dadurch gestÃĪrkt, dass hier explizit an das (erschÞtterte) Vertrauen zwischen EU-Staaten appelliert wurde. WÃĪhrend SchÃĪuble hier offiziell klarstellt, die SolidaritÃĪt (Deutschlands) kÃķnne nur gegen SoliditÃĪt (der ÂŧKrisenlÃĪnderÂŦ) gewÃĪhrleistet werden, wird insbesondere in deutschen Boulevard-Medien das Bild der Âŧfaulen GriechenÂŦ bedient. In diesem Kontext stellte dann etwa der damalige BundesbankprÃĪsident Axel Weber in der FAZ vom 28.2.2010 fest: ÂŧEin Beistand fÞr Griechenland ist in der WÃĪhrungsunion nicht vorgesehen (âĶ) Ich halte solche Hilfen fÞr kontraproduktiv, Griechenland muss den harten und steinigen Weg der Konsolidierung selbst gehen.ÂŦ Und wÃĪhrend Weber hier die politischen Konsequenzen fÞr Griechenland skizziert, betont Otmar Issing, ebenfalls frÞherer Chefvolkswirt bei der Bundesbank und ein zentraler Knotenpunkt deutscher neoliberaler Think-Tank-Netzwerke, das moralisch schuldhafte Verhalten, das zur Krise gefÞhrt habe: ÂŧNicht von ungefÃĪhr hat Griechenland, nicht zuletzt dank stark steigender BezÞge im Ãķffentlichen Dienst, den Abstand im Lebensstandard zum Durchschnitt der LÃĪnder der WÃĪhrungsunion oder auch zu Deutschland Þber die Jahre hinweg erheblich verkÞrzt. Dieser Aufholprozess war aber im Wesentlichen nicht durch ProduktivitÃĪtsfortschritte getragen, sondern Þber eine starke Ausweitung der Kredite und der Staatsausgaben erkauft. Zu einem jahrelangen Kurs der AusteritÃĪt, des Sparens und geringeren privaten wie Ãķffentlichen Konsums gibt es daher keine AlternativeÂŦ (Issing in der FAZ vom 20.2.2010).
Die Grundintention der Schuldenbremse und der EU-AusteritÃĪtspolitiken ist und war es, den fiskalpolitischen Spielraum fÞr Staaten einzuengen. Jetzt kann wieder â wie 2005 â ein Versagen der Politik konstatiert werden: ÂŧEs fehlten das Tempo und die Klarheit, um den MÃĪrkten zum richtigen Moment das richtige Signal zu schicken. Politikprozesse in unseren Demokratien sind nicht dafÞr geeignet, von heute auf morgen Tabus zu brechen oder sehr schnell Schocksignale nach drauÃen zu schickenÂŦ (Henrik Enderlein in der FAZ vom 20.5.2010).







Bei diesem Text handelt es sich um zwei leicht Þberarbeitete Kapitel aus dem Artikel der Autoren ÂŧWas ist eine Krise? Wie Ãķkonomische Theorien Wahrnehmung formenÂŦ, erschienen in der Ãķsterreichischen ▸Zeitschrift ÂŧKurswechselÂŦ Ausgabe 4 (2018). Schwerpunktthema dieser Heftausgabe ist die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008ff. Wir danken fÞr die Genehmigung zur ZweitverÃķffentlichung.
Walter Otto Ãtsch ist ein Ãķsterreichischer Ãkonom und Kulturwissenschaftler. Er ist Professor fÞr Ãkonomie und Kulturgeschichte an der Cusanus Hochschule Bernkastel-Kues.
Stephan PÞhringer ist Post-Doc Researcher am Institut fÞr die Gesamtanalyse der Wirtschaft an der Uni Linz.
