Wer soll das bezahlen? Zu den absehbaren finanzpolitischen Folgen der Corona-Krise

2. April 2020 | Kai Eicker-Wolf
Bund und Länder versuchen, den Absturz der Wirtschaft durch kreditfinanzierte Maßnahmen von enormer Größe abzufedern. Im Fokus steht dabei insbesondere das Hilfspaket des Bundes. Die Bundesregierung will Kredite in Höhe von 156 Milliarden Euro aufnehmen und rechnet mit Steuer-Mindereinnahmen in Höhe von 33 Milliarden Euro.
Zwar verfügt der Bund im Gegensatz zu den Bundesländern generell über die Möglichkeit, sich in Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu verschulden. Außerdem sieht die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse vor, dass konjunkturbedingte Auslastungsschwanken der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf den Bundeshaushalt die Aufnahme von Krediten ermöglicht. Da dieser Spielraum für den aktuellen Nachtragshaushalt nicht ausreicht, macht die Bundesregierung von der Ausnahmeregelung Gebrauch, nach der in einer außergewöhnlichen Notsituation Kredite zur Finanzierung von staatlichen Ausgaben möglich sind. Für diese Kredite ist allerdings ein Tilgungsplan aufzustellen, der die Rückzahlung »in angemessener Zeit« vorsieht. Für die knapp 100 Milliarden Euro, die der Bund an Krediten aufgrund der Ausnahmeregel aufnimmt, sind 20 Jahre festgeschrieben worden.
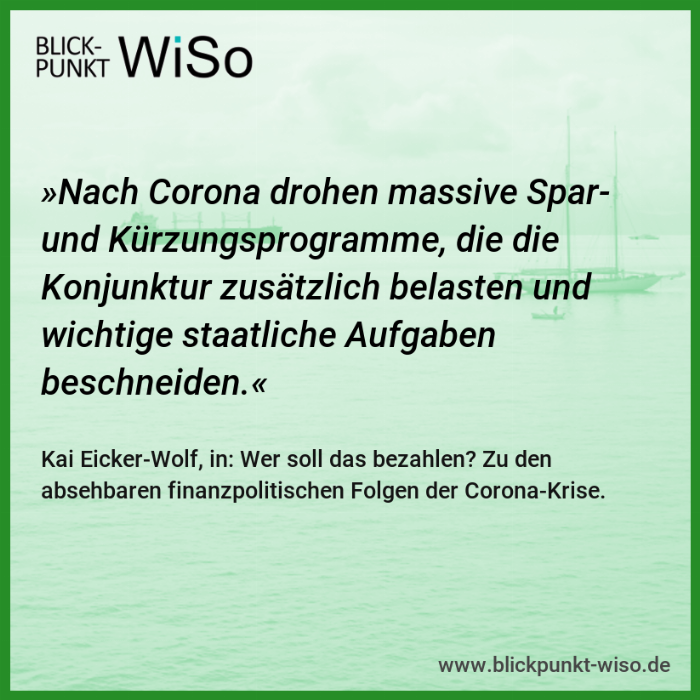 Ein großes Problem mit Blick auf die Corona-Krise ist die große Verunsicherung: Es ist nicht klar, wie lange die von der Bundesregierung verfügten Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung aufrecht erhalten werden müssen – und niemand kann sicher voraussagen, wie die ökonomischen Folgen ausfallen werden und ob weitere Maßnahmen nötig werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der wirtschaftliche Einbruch so stark oder sogar stärker ausfallen wird als in der Weltwirtschaftskrise 2008/09 – der Sachverständigenrat geht in seiner günstigsten Variante von einem Minus in Höhe von 2,8 Prozent aus, während das Münchner ifo Institut Schreckensszenarien von einem Wirtschafteinbruch in Höhe von bis zu 20 Prozent entwirft.
Ein großes Problem mit Blick auf die Corona-Krise ist die große Verunsicherung: Es ist nicht klar, wie lange die von der Bundesregierung verfügten Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung aufrecht erhalten werden müssen – und niemand kann sicher voraussagen, wie die ökonomischen Folgen ausfallen werden und ob weitere Maßnahmen nötig werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der wirtschaftliche Einbruch so stark oder sogar stärker ausfallen wird als in der Weltwirtschaftskrise 2008/09 – der Sachverständigenrat geht in seiner günstigsten Variante von einem Minus in Höhe von 2,8 Prozent aus, während das Münchner ifo Institut Schreckensszenarien von einem Wirtschafteinbruch in Höhe von bis zu 20 Prozent entwirft.
Wir wirken die MaĂźnahmen?
Die staatlichen Maßnahmen von Bund und Ländern sind zum einen direkt als Hilfen zur Stärkung des Gesundheitssystems und zur Pandemiebekämpfung gedacht. Außerdem erhalten kleine Unternehmen, Selbständige und Freiberufler Zuschüsse für ihre Betriebskosten, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Darüber hinaus gründet der Bund einen Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit einem Volumen von insgesamt 600 Milliarden Euro, der sich insbesondere an große Unternehmen richtet. 400 Milliarden Euro sind dabei als Garantie für Schulden von Großunternehmen vorgesehen, 100 Milliarden Euro für direkte Staatsbeteiligungen an Unternehmen. Außerdem sind bis zu 100 Milliarden Euro als Beteiligung an Programmen der staatlichen KfW-Bank veranschlagt – die KfW übernimmt bis zu 90 Prozent des Kreditrisikos, wenn Unternehmen Kredite von ihren Banken bekommen.
Das wichtigste Hilfsinstrument für die abhängig Beschäftigten ist die so genannte Kurzarbeit bzw. das in diesem Zusammenhang bezahlt Kurzarbeitergeld. Im Falle von Kurzarbeit wird die übliche Arbeitszeit aufgrund eines vorübergehenden Arbeitsausfalls verringert. Von der Kurzarbeit können einige oder alle Beschäftigte in einem Betrieb betroffen sein. Kurzarbeitergeld wird gezahlt, um Entlassungen zu vermeiden. Es dient dazu, den Verdienstausfall der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zumindest in Teilen auszugleichen. Für Beschäftigte mit mindestens einem Kind beträgt es 67 Prozent, für die anderen 60 Prozent des ausgefallenen Nettoentgelts. Zum Teil wird das Kurzarbeitergeld aufgrund tarifvertraglicher oder betrieblicher Vereinbarungen aufgestockt.
So positiv die geschilderten Maßnahmen der Bundesregierung, die durch entsprechende Aktivitäten auf der Ebene der Bundesländer ergänzt werden, auch zu bewerten sind – sie werden einen dramatischen Absturz der deutschen Konjunktur nicht verhindern können. Da das Kurzarbeitergeld die Einkommenseinbußen der abhängig Beschäftigten nicht voll wettmacht und da die gegen die Corona-Pandemie verhängten Maßnahmen Konsummöglichkeiten drastisch einschränken, wird es zu Nachfrageausfällen kommen. Aber auch andere Personen wie Selbständige und Freiberufler werden zum Teil erhebliche Einkommenseinbußen aufweisen, die nicht ausgeglichen werden. Zusätzliche Kredite, die von Unternehmen jetzt aufgenommen werden müssen, können auch trotz der Unterstützungsprogramme schnell zur Überschuldung führen. Zudem dürfte eine hohe Unsicherheit sowohl bei den privaten Haushalten als auch bei den Unternehmen bestehen, solange die medizinische Lage nicht vollkommen unter Kontrolle ist. Diese Unsicherheit aber dürfte bei den privaten Haushalten zu einer allgemeinen Kaufzurückhaltung bei Gütern für den langfristigen Gebrauch führen. Und Unternehmen werden Investitionen aufschieben. Zudem dürfte sich im Rahmen der Corona-Krise die hohe Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft vom Außenhandel als Problem erweisen: Es ist ein erheblicher Einbruch der Exportnachfrage zu erwarten. Letztlich ist die Tiefe des wirtschaftlichen Einbruchs davon abhängig, wie lange die aufgrund der Pandemie ergriffenen Maßnahmen aufrechterhalten werden müssen.
Wenig Beachtung in der öffentlichen Debatte um die Krise findet im Moment die finanzielle Lage der Gemeinden, Städte und Landkreise. Auf diese kommen erhebliche Probleme zu, da sie mit dem Wegbrechen ihrer Einnahmen aus Steuern, dem Nahverkehr und öffentlichen Einrichtungen (z.B. Schwimmbädern) zurecht kommen müssen. Problematisch ist dies, weil viele Kommunen bereits in der Vergangenheit erhebliche Sparanstrengungen unternommen haben, um ihre Haushalte auszugleichen und Kredite abzubauen. Gerade auf der kommunalen Ebene besteht ein erheblicher Investitionsstau etwa im Bereich der Schulen und der Verkehrsinfrastruktur. Zurückgehende Einnahmen aus Steuern drohen hier die sowieso viel zu geringe Investitionstätigkeit weiter zu einzuschränken. Hinzu kommt ein Mangel an Personal in vielen Bereichen, zu denken ist etwa an die Kindertageseinrichtungen.
Die europäische Ebene
Auf der europäischen Ebene ist der Stabilitätspakt ausgesetzt worden. Dadurch unterliegen die Länder der Eurozone keinen Beschränkungen bei der Aufnahme von Schulden, um die Corona-Krise zu bekämpfen. Um weitere Maßnahmen gibt es zwischen den Euroländern aktuell aber heftigen Streit. So fordern Frankreich, Irland, Portugal, Belgien, Luxemburg, Griechenland, Spanien und Slowenien die Einführung von Euro- bzw. Corona-Bonds – unter anderem weil befürchtet wird, dass die Finanzmärkte gegen Länder wie Spanien oder Italien spekulieren und deren Finanzierungskosten nach oben treiben. Gemeinsam aufgenommene Anleihen sollen Mittel mobilisieren, die dann insbesondere hochverschuldeten südeuropäischen Ländern helfen.
Unter Politikern und Ökonomen wird auch über die Nutzung des Europäischen Stabilisierungsmechanismus (ESM) als Finanzierungsinstrument im Rahmen der Corona-Krise diskutiert. Die Aufgabe dieser im Jahr 2012 gegründeten Institution ist es eigentlich, Euroländern in einer finanziellen Notlage durch Kredite und Bürgschaften zu helfen. Der ESM könnte derzeit 410 Milliarden Euro zur Verfügung stellen – die von der Coronakrise betroffenen Länder könnten Kredite in Höhe von zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung erhalten. Diese ESM-Mittel dürften allerdings schnell zu Neige gehen. Außerdem ist die Vergabe der Mittel eigentlich an Auflagen geknüpft.
Zur finanziellen Stabilisierung der Lage in der Eurozone trägt aktuell die Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) bei. Sie hat ein Pandemie-Notfall-Kaufprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro für dieses Jahr verkündet. Zusammen mit bereits bestehenden Kaufprogrammen ergibt sich rechnerisch so ein monatliches Kaufvolumen von 100 Milliarden Euro. Hinzu kommt, dass die EZB die bisher bestehende Regel suspendiert hat, nicht mehr als ein Drittel der ausstehenden Anleihen eines Landes zu kaufen. Die EZB kann so verhindern, dass die Renditen der Staatsanleihen von Ländern wie Italien oder Spanien und damit die Zinskosten der betroffenen Staaten steigen. Faktisch stellt die EZB durch den Erwerb der Staatsanleihen am Sekundärmarkt die Kreditfinanzierung der öffentlichen Haushalte der Euro-Staaten sicher.
Probleme…
Die aktuelle Krisenpolitik der Bundesregierung ist mit Blick auf den Stabilisierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage in Deutschland vom Grundsatz her absolut richtig und angemessen – hinterfragt werden kann natürlich, ob die ergriffenen Maßnahmen ausreichen. Die Antwort auf diese Frage dürfte vor allem davon abhängen, wie lange die krisenbedingten Maßnahmen im Inland noch andauern und wie stark die Exportnachfrage einbricht.
Große Probleme werden allerdings aufgrund der Schuldenbremse auf die öffentlichen Haushalte zukommen: Falls die Krise überwunden werden sollte, besteht der Zwang zur Tilgung der jetzt aufgenommenen Kredite. Außerdem müssen die Defizite in den Haushalten zurückgeführt werden. So drohen massive Spar- und Kürzungsprogramme, die die Konjunktur zusätzlich belasten und wichtige staatliche Aufgaben beschneiden. Hier entpuppt sich die Schuldenbremse einmal mehr als höchst fragwürdig.
Problematischer als in Deutschland ist allerdings die Lage in den südeuropäischen Ländern. Hier liegt die Staatsverschuldung aufgrund der Euro-Krise aktuell schon auf einem Niveau zwischen knapp 100 und 175 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Diese Länder, die bereits jetzt eine hohe Arbeitslosigkeit aufweisen, sind alleine nicht in der Lage, kreditfinanzierte Maßnahmen im Umfang wie Deutschland zu ergreifen. Die ökonomische Situation in diesen Ländern droht sich in der nächsten Zeit unter anderem deshalb weiter zuzuspitzen, weil ihre Wertschöpfung stark vom Tourismus abhängt – in Portugal, Spanien, Griechenland und Italien sind dies zwischen zehn und 20 Prozent. Der zu befürchtende Rückgang der Urlaubsreisen in diese Länder wird Wirtschaft und Beschäftigung in erheblichem Umfang belasten.
…und Lösungen
Um die Probleme der Eurozone zu lösen, wären zunächst einmal die schon erwähnten Corona-Bonds ein geeignetes Instrument. Durch die gemeinsame Haftung für die Staatsschulden könnten ausreichend Mittel mobilisiert werden, um auch den hochverschuldeten europäischen Staaten genug Geld zur Bewältigung der aktuellen Krise zukommen zu lassen. Diese Länder mahnen zurecht eine europäische Lösung der Corona-Krise an. Wird diese Lösung nicht gewählt, dürfte die Gefahr sehr hoch sein, dass die Eurozone und damit die gesamt Europäische Union auseinander brechen.
Das Problem der steigenden Verschuldung im Euroraum könnte die Europäische Zentralbank lösen, indem sie die Corona-Bonds und/oder jetzt alle aufgrund der Krise national emittierten Staatsanleihen aufkauft – und diese Staatsverschuldung nach der Krise dann einfach stillgelegt bzw. gestrichen wird. Dies würde auf eine Direktfinanzierung der staatlichen Haushalte der Eurozone hinauslaufen und einen Tabubruch mit der neoliberalen Zentralbank-Doktrin darstellen.
Eine Direktfinanzierung des Staates durch Notenbanken wird in Politik und Öffentlichkeit meist abgelehnt, weil hierdurch eine nachfrageseitig angetriebene Inflation befürchtet wird. Diese Sorge ist grundsätzlich nicht unbegründet, allerdings ist eine partiell betriebene Staatsfinanzierung durch Notenbanken auch kein Novum. Zumindest in der jetzigen Lage wäre sie angemessen. Die Angst vor Inflation sollte dabei nicht übertrieben werden: In der aktuellen Situation einer allgemein zusammenbrechenden Nachfrage ist ein starker Anstieg der Preissteigerung nicht zu erwarten. Vielmehr kommt es aktuell darauf an, Zahlungsketten möglichst aufrecht zu erhalten und schon hochverschuldeten Staaten die Möglichkeit zu eröffnen, dringend erforderliche Maßnahmen zu ergreifen.
Würden die Staatsschulden aufgrund der Corona-Krise nach einer wirtschaftlichen Erholung gestrichen, könnten die öffentlichen Haushalte ohne sie strangulierende Zahlungsverpflichtungen die Folgen der Krise bewältigen, wobei die Finanzierung dieser Aufgaben die in den meisten Staaten auszumachende steigende Ungleichheit von Einkommen und Vermögen korrigieren sollte.







Kai Eicker-Wolf ist Wirtschaftswissenschaftler und Gewerkschaftssekretär.
